Die Münchner Turmschreiber trauern um ihr hochgeschätztes Mitglied Dr. Walter Flemmer. Der vielfach ausgezeichnete Autor, Journalist, Herausgeber und langjährige stellvertretende Fernsehdirektor und Kulturchef des Bayerischen Rundfunks ist im Alter von 88 Jahren verstorben. In seinem Andenken veröffentlichen wir eine Erinnerung von 2004 – mit freundlicher Genehmigung von Florian Besold:
Zu beschreiben ist einer, der „verdächtig“ ist: Sachbuchautor, Verfasser erzählender Prosa, Lyriker, Herausgeber von Anthologien, Librettist – Verfasser eines Passions-Textes gar -, all dies und dann noch berufeshalber Fernsehjournalist, jahrzehntelang „Kulturchef des Bayerischen Fernsehens“ (bis 2001): das ist zu viel, zu viel für eine Zeit, die nur dem spezialisierten Spezialisten Lorbeeren windet und dem misstraut, der vieles kann.
„Verdächtig“ aber auch, dass es noch solche Lebensläufe geben sollte: Urmünchner ist er, d.h. er kann auf Münchner Eltern und Großeltern verweisen, genauer: er ist Sendlinger, mit aufregendster Münchner Geschichte also von Geburt an vertraut. Obgleich Schüler der naturwissenschaftlich orientierten Ludwigs-Oberrealschule im München der Bombenangriffe, drängte es ihn zu Sprache, Literatur und Theater, erste Gedichte entstanden, Theaterstücke und auch deren Inszenierung. Das folgende Studium der Germanistik, Geschichte, Philosophie, Geographie und Theaterwissenschaft unterstützte er – sowohl die menschlichen Erfahrungen als auch die finanziellen Möglichkeiten anreichernd – als Straßenbahnschaffner, in der Großmarkthalle, auf dem Bau und schließlich mit ersten journalistischen Arbeiten für Zeitungen, Verlage und Hörfunk, was ihn schließlich in einen Verlag brachte, in dem er nicht nur das Bücherschreiben, sondern auch das Büchermachen erlernte. Noch während des Studiums traf er auf Prof. Dr. Edgar Hederer, wirkte mit an der Herausgabe von Lyrikanthologien und war bereits ab Anfang der 60-er Jahre Herausgeber von 28 Bänden einer beachtlichen Werkausgabe zur deutschen klassischen Literatur.
1962 kam er zum Bayerischen Rundfunk/Fernsehen, wurde mit 30 Jahren der jüngste Fernsehabteilungsleiter, baute ein beispielhaftes Erwachsenen-Bildungs- und Erziehungsprogramm auf, war international und national bereits gefragt als Vortragender und Schreibender der renommiertesten Medien. Seit 1971 in immer größeren Bereichen verantwortlich für den Kulturbereich des Bayerischen Fernsehens, führten ihn schon bald Vortragsreisen um die ganze Welt, für ihn Gelegenheit seine unbändige Neugier zu befriedigen und seine Achtung für fremde Kulturen in der ihm eigenen Gründlichkeit zu vertiefen. Insbesondere die Begegnung mit der japanischen Kultur, mit dem Zen-Buddhismus war ihm wichtig als Quelle eigenen Schreibens, als prägender Hintergrund auch für die Haltung einer gelassenen Aufmerksamkeit gegenüber Welt und eigener Person. Dieser Neigung entsprang auch die Idee zum berühmt gewordenen Programm „Z.E.N“ (Zuschauen, Entspannen, Nachdenken), einer den Gesetzen modernen Fernsehschaffens völlig gegenläufigen Sendung, deren Titel auch mit „Zeit einräumen zum Nachdenken“ übersetzt werden könnte.
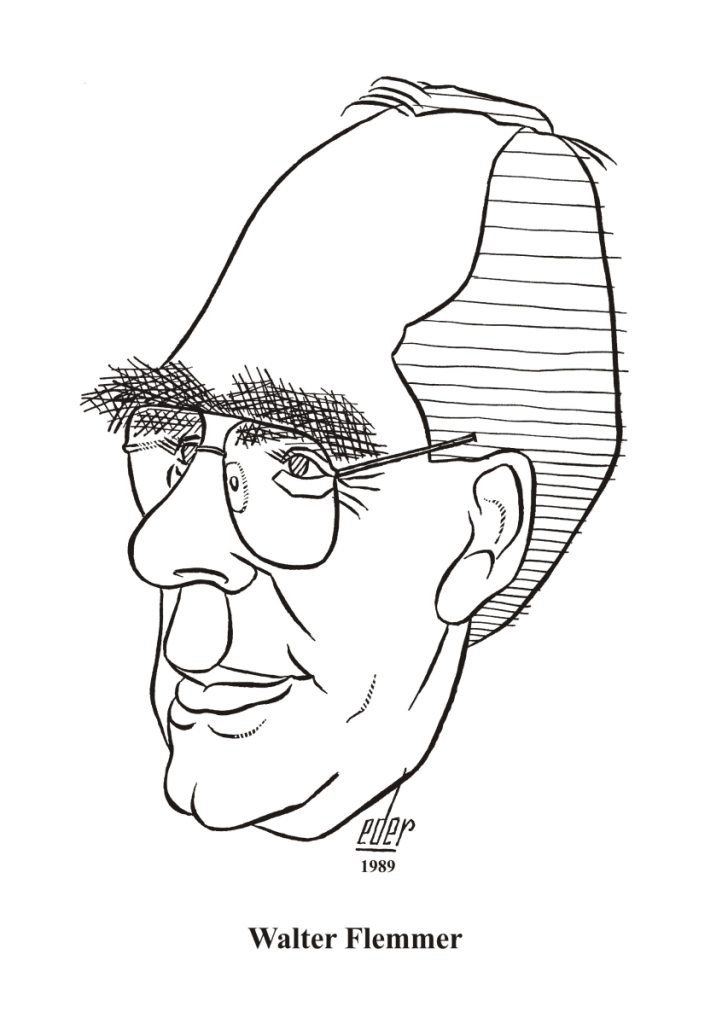
Diese Zeit hat sich Walter Flemmer auch genommen, nachdem er 1983 Kulturchef des Bayerischen Fernsehens und 1990 Stellvertretender Fernsehdirektor wurde, er hat sie sich vor allem auch genommen für seine Begabung als Schriftsteller und Autor, damit befruchtend seinen beruflichen Weg und umgekehrt schöpfend aus den reichen beruflichen Erfahrungen für das schriftstellerische Schaffen. Dies schriftstellerische Wirken ist vielschichtig, sowohl thematisch als auch im Genre, so finden sich in der Rubrik „Sachbücher“ Titel wie „Kinder vor der Flimmerkiste“ (Eltern-Ratgeber), „Lebendige Stille – Betrachtungsgärten in Japan“, „Das Alte China“ oder auch „Verantwortung vor Gott“. Zwei wichtige Anthologien seien erwähnt: „Dem Leben trauen – Deutsche Trost- und Mut-gedichte vom Barock bis zur Gegenwart“ und insbesondere – 1986 schon erschienen – „Weil’s uns freut – Das große Buch der bayerischen Lyrik aus zwei Jahrhunderten“, eine bemerkenswerte Zusammenstellung bayerischer Mundartgedichte, die überraschend viel Unbekanntes und Unbekannte zutage fördert.
Der „Literat“ offenbart sich aber in seiner erzählenden Prosa und Lyrik. In ihr verwirklicht sich die eigentliche schriftstellerische Begabung Walter Flemmers, die den Umgang mit dem Wort nicht zum stilistisch-artistischen Blendwerk missbraucht, sondern zur aufrichtig eindringlichen und sich selbst verpflichteten Sprachkunst werden lässt. „Das Messer im Leib der Puppe“ (Roman, Steinhausen Verlag), „Der Reiche, der nicht sterben wollte“ (Droemer Verlag) oder etwa „Das Glückshemd und andere märchenhafte Geschichten“ (Turmschreiber Verlag) bestätigen dies nachhaltig, ebenso wie auf ihre Art die schon im Jahr 1971 erschienenen „Vier Kinderbücher“ (Verlagsgruppe Bertelsmann).
Diese Fähigkeiten muss vor allem. aber der haben, der sich an Mundartlyrik wagt. „Oamai ois Woikn schweem“ (W. Ludwig Verlag) zum Beispiel – in diesem köstlichen Band erbringt Walter Flemmer den Nachweis, dass Mundart, frei von süßlicher Biederkeit, zu eindringlicher Lyrik taugt. Vollendet aber hat sich die große lyrische Begabung Walter Flemmers in dem fast unscheinbar schmalen Gedichtband „Vogelnarben auf der Stirn – Haiku“ (erschienen im Verlag St. Michaelsbund). Haiku – das ist die extreme, kürzeste Form eines japanischen Gedichts, die von einem namhaften Literaturhistoriker als „die höchste Blüte der östlichen Kultur“ bezeichnet wird. Flemmer muss in der Tat „Haiku“ verinnerlicht haben, sonst wäre es nicht denkbar, dass er in dieser Lyrikform selbst einen Gedichtband erstellte, der in lauter Dreizeilern aufs Faszinierendste erfüllt, was ein anderer Kenner des „Haiku“ so ausdrückt: „Ein Haiku-Moment ist so etwas wie ein ästhetischer Moment, in dem die Worte, die die Erfahrung schufen, und die Erfahrung selbst eins werden können.“
Den Boden für dieses tiefe Verständnis anderer Kulturformen hat Flemmer in seiner Autorenschaft vieler eindringlicher Fernsehdokumentationen über den Nahen und Fernen Osten bereitet.
In welcher Weise sein berufliches und schriftstellerisches Wirken geprägt ist von christlichem Glauben und abendländischer Kultur verdeutlicht sich eindrucksvoll in seinem Wirken als Librettist, v.a. seinen Texten zur Kantate „Menschenrechte“ (Komponist Michael Hamel, 1999 Uraufführung) und dem tief berührenden Passionstext zu einem Oratorium, komponiert von Michael Hamel, Uraufführung 1997).
„Verdächtig“ in seiner Vielseitigkeit ist er eingangs benannt – sein Werk lässt den Verdacht verstummen.
Aus: Schweiggert Alfons/ Macher Hannes S.(Hrsg): Autoren und Autorinnen in Bayern, 20, Jahrhundert, Dachau 2004
Karikatur: Franz Eder
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.